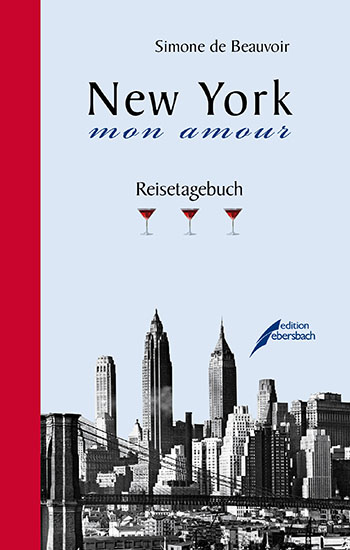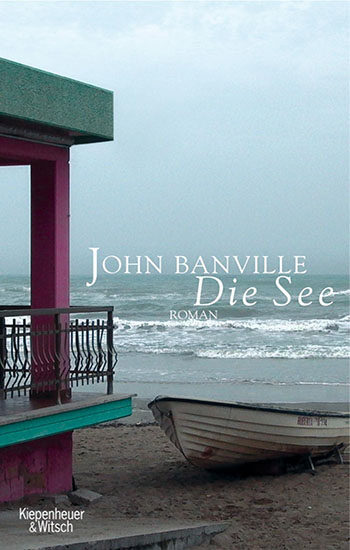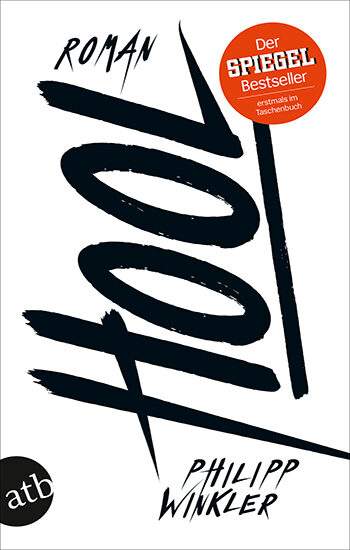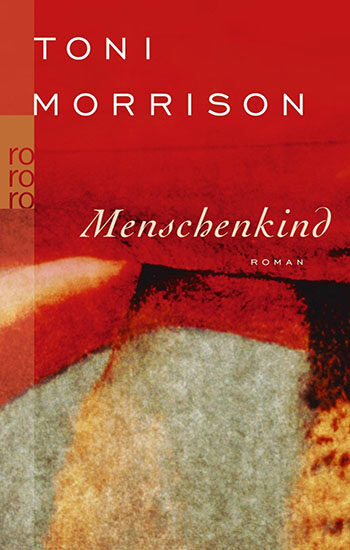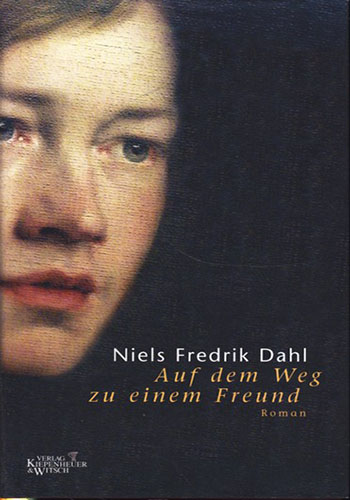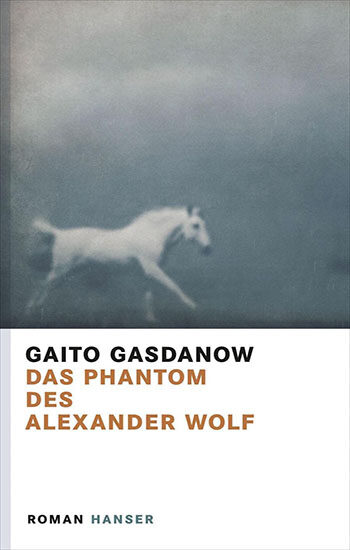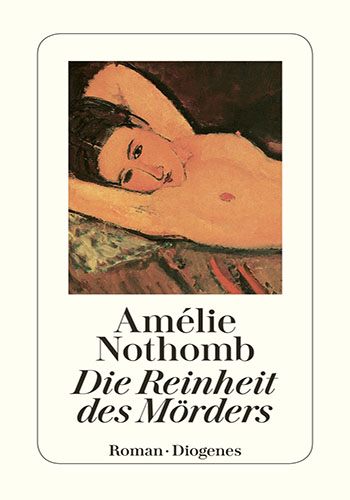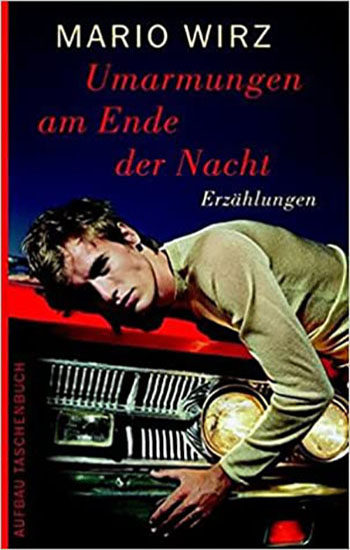New York mon amour
Wenn ich New York entziffern will, muss ich mich an New Yorker wenden. In meinem Büchlein stehen Namen, aber für mich steht kein Gesicht hinter ihnen.Beim Griff ins Regal habe ich es nicht gemerkt – erst beim Vorwort ist mir klar geworden, dass es sich bei diesem schmalen Reisebuch um einen Auszug handelt. Simone de Beauvoir war 1947 zu einer Vortragsreise in die USA eingeladen worden. Sie zögerte keinen Augenblick und flog am 25. Januar des Jahres über den Atlantik, nicht in ein fremdes Land, wie sie notiert, sondern in eine andere Welt. Ursprünglich veröffentlichte sie ihre Eindrücke von “drüben” unter dem Titel »L’Amèrique – au jour le jour«, aus dem diese Auszüge stammen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Vorzeigeintellektuelle Frankreichs: Ihr Buch »Das andere Geschlecht«, mit dem sie weltberühmt wird, erscheint erst 1949.
Für mich ist Simone de Beauvoir im Romanistik-Studium Pflichtlektüre gewesen. Ihr klarer Stil, ihre noch klareren Vorstellungen und ihre Selbstverständlichkeiten haben mich beeindruckt. Sie war für mich der feste Bestandteil des intellektuellen Nachkriegs-Paris und obwohl ich wusste, dass sie viel gereist war, fand ich sie – und deshalb wohl der Griff ins Regal – als Reiseführerin spannend. Zumal ich selbst einmal kurz in New York war, 11 Tage nur, aber die habe ich nicht vergessen.
Erst im Laufe der Lektüre ist mir klar geworden, wie nah sie am Ende des Zweiten Weltkrieges reiste. Die gleichaltrigen Männer dort waren oft genug Soldaten gewesen, die Frankreich und später Deutschland befreit haben. Sie kam vor allem in eine Welt des Überflusses, von dem man im Europa des Jahres 1947 nur träumen konnte (und das waren sicher selten Alpträume). Dennoch habe ich gerade in den von ihr beschriebenen ersten Tagen viel von dem wiedergefunden, was ich selbst in den ersten Tagen (und verglichen mit Simone de Beauvoirs Reise bestand mein Trip ja quasi nur aus ersten Tagen) empfand: diese Dankbarkeit den Amerikanern gegenüber (ja, immer noch und trotz allem, was berechtigterweise die Beziehungen der letzten Jahre getrübt hat), dieser irrwitzige Überfluss in jedem einzelnen Drugstore, diese vielen winzig kleinen Überraschungen der anderen Kleider, der neuen Gesichter, der Gerüche, der Gewohnheiten und der große – wie sie es empfindet – Gebirgshimmel über der Stadt.
Statt nach der langen Reise und noch einem Essen mit ihren offiziellen amerikanischen Gastgebern direkt ins Hotelbett zu gehen, saust sie gleich wieder aus der Lobby, um die erste Entdeckerfreude ganz auszukosten. Sie schläft überhaupt wenig in der New Yorker Zeit, einmal denkt sie, ihr Herzschlag gehe hier anders, schneller, und erlaube ihr, weniger zu schlafen. Am Ende des ersten Tages, an dem sie – nein, nicht kreuz und quer, sondern mit Liste, Stadtplan und Notizheft – durch Uptown gelaufen ist, wird ihr schummrig. Sie löst sich auf, wie sie schreibt, und schaut nur noch. Auch das kenne ich, das Rauslaufen aus dem Hotel trotz fast schon schmerzhafter Müdigkeit, das Staunen und nur noch Staunen können.
Aber schon bald trennen sich unsere Erfahrungen, denn sie war ja unter anderem auch dort, um Vorträge zu halten, ich blieb die knapp zwei Wochen Touristin. Als erstes nimmt sie einen zum Schuhputzer mit, dann in einen Schreibsalon, in den ich ihr mit großen Augen folge (komme mir noch mal jemand damit, die Idee der tageweise mietbaren Schreibtische in Großraumbüros sei neu…), zum Friseur. Dort spürt sie, Teil der Stadt zu werden, die sie in den ersten Tagen wie ein Gespenst nur durchwandert zu haben glaubt. Ein treffender Vergleich, wie mir scheint, denn wer nur herumgeht, fühlt sich schnell als Gespens. Aber einen gemeinsamen Termin haben wir – trotz der 54 Jahre, die zwischen unseren Reisen liegen – dann doch noch: Das Frühstück im Deli. Auch ich hatte nach zwei Tagen das Hotel hungrig verlassen, um an der nächsten Ecke bei Zabar’s zu frühstücken. Und auch ich hatte sofort das Gefühl, Teil eines amerikanischen Morgens zu sein, denn ich wurde angesprochen, in das Gespräch über den Tisch hinweg mit einbezogen. Und auch ich wurde rot ob meiner kläglichen Englischkenntnisse. Ohne Grund, denn New Yorker gehen immer noch gelassen und freundlich mit den Sprachproblemen der Zugereisten um.
Während ich also schon bald wieder die Koffer packe, nimmt das Leben Simone de Beauvoirs in der neuen Umgebung erst richtig Fahrt auf. Sie trifft sich erst mit französischen Freunden von Freunden. Nach und nach lernt sie Amerikaner kennen, besucht deren Partys und natürlich auch die Redaktionsbüros der Stadt. Denn sie will (und muss) Dollars verdienen. Sie geht alleine durch Harlem, und am nächsten Tag kauft sie zum ersten Mal die Tageszeitungen, um auch in New York mit ihrem französischen Alltag fortzufahren, morgens Zeitung zu lesen (amerikanische, sie ist schließlich da, in diese Stadt, in das Land völlig einzutauchen). Ihr Englisch wird besser, sie diskutiert an den Abenden mit den neuen Freunden, die Themen stehen ihr vor Augen: Rassenprobleme, die Situation der New Yorker Juden, die Gefahren des Kalten Krieges, die Ungleichheit der amerikanischen Gesellschaft, die ihr trotz des Wohlstandes sofort in die Augen sticht. Mitte Februar beginnt ihre Vortragsreise, die sie bis an den Pazifik bringt, sie kehrt Ende April nach New York zurück, diesmal ins West-Village, wo sie ein Quartier-Leben führt mit Nachbarn, Freunden und kleinen Bummeleien, wie sie es aus Paris kennt. Sie fühlt sich angekommen, vielleicht auch nicht zuletzt, weil sie einen amerikanischen Liebhaber gefunden hat, einen Schriftsteller aus Chicago, dem sie ihr New York zeigen kann und mit dem sie doch ganz neue Eindrücke erlebt.
Die Zeit rennt ihr davon. Sie schläft kaum noch, beherrscht die englische Sprache leidlich, jedoch noch nicht gut genug, um – wie sie schreibt – völlig frei in ihr denken zu können. Jetzt dringt sie noch einmal tiefer ein in den amerikanischen Lifestyle, sie sieht, wie hier alles auf Geld fixiert ist und nur der ein gemachter Mann ist, der welches hat (Talent zu haben reicht dagegen nicht). Sie sieht ihre eigenen Landsleute plötzlich in einem neuen, eher unvorteilhaften Licht und sie findet ihr großes Thema, auf das sie vielleicht im eigenen Land nicht so schnell gestoßen wäre: Die Rolle der Frauen. Denn erst im Kontrast zur Französin wird ihr klar, wie umemanzipiert die von ihr vorab als unabhängig gedachte Amerikanerin ist. Es ist die Amerikareise, die den Keim legt zu ihrer großes Studie über »das andere« Geschlecht. Sie macht noch en passant eine Marijuana-Erfahrung, die keine wird, weil der Stoff bei ihr nicht anschlägt, sie isst am Ende der Reise am liebsten Hamburger mit Whisky und sie ist sich sicher, dass sie Amerika zumindest zu 50% liebt, was für eine französische Intellektuelle ihrer Zeit ein riesiges Kompliment ist. Als sie fährt, ist sie traurig. »New York hat mich akzeptiert«, schreibt sie an einem ihrer letzten Nachmittage, an denen sie an einer Ballett-Probe mit John Cage und Merce Cunningham teilnehmen darf. Den letzten Abend verbringt sie mit Freunden in Harlem. Und dann fliegt sie ins triste Nachkriegs-Paris zurück. »Ich riskierte nie etwas, ich war Zuschauer.« So klingt ihr Resümee und auch der Grund, warum sie trotz aller Begeisterung zurück muss. Sie kann trotz aller Beschäftigung keinen Alltag in New York finden, denn ihr fehlt ihre Arbeit.
Meine hiesigen Freunde gehen ihren Berufen nach, haben ihre Alltagssorgen, stehen vor den Problemen, von denen ich sprach. Ich bin eine Außenstehende. (…) Je vertrauter mir diese Welt ist, um so stärker fühle ich das Bedürfnis, einen wirklichen Platz in ihr einzunehmen – vielleicht fände ich ihn auch, wenn ich länger bleiben könnte. Aber in zehn Tagen wird nicht mehr die Rede davon sein, ihn zu suchen. New York ist keine Fata Morgana mehr, die ich erst in eine Stadt in Fleisch und Blut verwandeln muss, es ist eine betäubende Wirklichkeit, es hat die Dichte und den Widerstand der Wirklichkeit. Nichts werde ich von dieser Stadt erhalten, es sei denn, ich gäbe mich ihr ganz; um aber ein solches Geschenk möglich zu machen, müsste ich meine Existenz von Grund auf ändern. Es ist mir bestimmt, hier nur Besucherin, Durchreisende zu sein. Morgen früh werde ich mir ein Flugbillett für Chicago reservieren lassen.Rezension von Stephanie Jaeckel
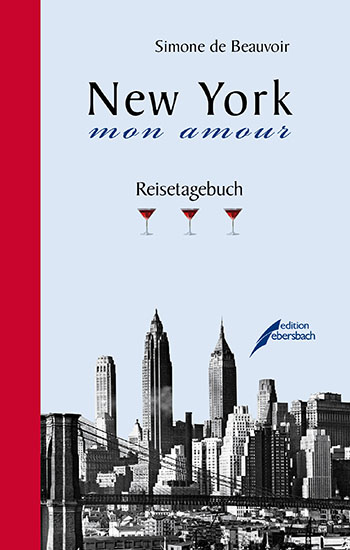
New York mon amour
New York mon amour
Wenn ich New York entziffern will, muss ich mich an New Yorker wenden. In meinem Büchlein stehen Namen, aber für mich steht kein Gesicht hinter ihnen.Beim Griff ins Regal habe ich es nicht gemerkt – erst beim Vorwort ist mir klar geworden, dass es sich bei diesem schmalen Reisebuch um einen Auszug handelt. Simone de Beauvoir war 1947 zu einer Vortragsreise in die USA eingeladen worden. Sie zögerte keinen Augenblick und flog am 25. Januar des Jahres über den Atlantik, nicht in ein fremdes Land, wie sie notiert, sondern in eine andere Welt. Ursprünglich veröffentlichte sie ihre Eindrücke von “drüben” unter dem Titel »L’Amèrique – au jour le jour«, aus dem diese Auszüge stammen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Vorzeigeintellektuelle Frankreichs: Ihr Buch »Das andere Geschlecht«, mit dem sie weltberühmt wird, erscheint erst 1949.
Für mich ist Simone de Beauvoir im Romanistik-Studium Pflichtlektüre gewesen. Ihr klarer Stil, ihre noch klareren Vorstellungen und ihre Selbstverständlichkeiten haben mich beeindruckt. Sie war für mich der feste Bestandteil des intellektuellen Nachkriegs-Paris und obwohl ich wusste, dass sie viel gereist war, fand ich sie – und deshalb wohl der Griff ins Regal – als Reiseführerin spannend. Zumal ich selbst einmal kurz in New York war, 11 Tage nur, aber die habe ich nicht vergessen.
Erst im Laufe der Lektüre ist mir klar geworden, wie nah sie am Ende des Zweiten Weltkrieges reiste. Die gleichaltrigen Männer dort waren oft genug Soldaten gewesen, die Frankreich und später Deutschland befreit haben. Sie kam vor allem in eine Welt des Überflusses, von dem man im Europa des Jahres 1947 nur träumen konnte (und das waren sicher selten Alpträume). Dennoch habe ich gerade in den von ihr beschriebenen ersten Tagen viel von dem wiedergefunden, was ich selbst in den ersten Tagen (und verglichen mit Simone de Beauvoirs Reise bestand mein Trip ja quasi nur aus ersten Tagen) empfand: diese Dankbarkeit den Amerikanern gegenüber (ja, immer noch und trotz allem, was berechtigterweise die Beziehungen der letzten Jahre getrübt hat), dieser irrwitzige Überfluss in jedem einzelnen Drugstore, diese vielen winzig kleinen Überraschungen der anderen Kleider, der neuen Gesichter, der Gerüche, der Gewohnheiten und der große – wie sie es empfindet – Gebirgshimmel über der Stadt.
Statt nach der langen Reise und noch einem Essen mit ihren offiziellen amerikanischen Gastgebern direkt ins Hotelbett zu gehen, saust sie gleich wieder aus der Lobby, um die erste Entdeckerfreude ganz auszukosten. Sie schläft überhaupt wenig in der New Yorker Zeit, einmal denkt sie, ihr Herzschlag gehe hier anders, schneller, und erlaube ihr, weniger zu schlafen. Am Ende des ersten Tages, an dem sie – nein, nicht kreuz und quer, sondern mit Liste, Stadtplan und Notizheft – durch Uptown gelaufen ist, wird ihr schummrig. Sie löst sich auf, wie sie schreibt, und schaut nur noch. Auch das kenne ich, das Rauslaufen aus dem Hotel trotz fast schon schmerzhafter Müdigkeit, das Staunen und nur noch Staunen können.
Aber schon bald trennen sich unsere Erfahrungen, denn sie war ja unter anderem auch dort, um Vorträge zu halten, ich blieb die knapp zwei Wochen Touristin. Als erstes nimmt sie einen zum Schuhputzer mit, dann in einen Schreibsalon, in den ich ihr mit großen Augen folge (komme mir noch mal jemand damit, die Idee der tageweise mietbaren Schreibtische in Großraumbüros sei neu…), zum Friseur. Dort spürt sie, Teil der Stadt zu werden, die sie in den ersten Tagen wie ein Gespenst nur durchwandert zu haben glaubt. Ein treffender Vergleich, wie mir scheint, denn wer nur herumgeht, fühlt sich schnell als Gespens. Aber einen gemeinsamen Termin haben wir – trotz der 54 Jahre, die zwischen unseren Reisen liegen – dann doch noch: Das Frühstück im Deli. Auch ich hatte nach zwei Tagen das Hotel hungrig verlassen, um an der nächsten Ecke bei Zabar’s zu frühstücken. Und auch ich hatte sofort das Gefühl, Teil eines amerikanischen Morgens zu sein, denn ich wurde angesprochen, in das Gespräch über den Tisch hinweg mit einbezogen. Und auch ich wurde rot ob meiner kläglichen Englischkenntnisse. Ohne Grund, denn New Yorker gehen immer noch gelassen und freundlich mit den Sprachproblemen der Zugereisten um.
Während ich also schon bald wieder die Koffer packe, nimmt das Leben Simone de Beauvoirs in der neuen Umgebung erst richtig Fahrt auf. Sie trifft sich erst mit französischen Freunden von Freunden. Nach und nach lernt sie Amerikaner kennen, besucht deren Partys und natürlich auch die Redaktionsbüros der Stadt. Denn sie will (und muss) Dollars verdienen. Sie geht alleine durch Harlem, und am nächsten Tag kauft sie zum ersten Mal die Tageszeitungen, um auch in New York mit ihrem französischen Alltag fortzufahren, morgens Zeitung zu lesen (amerikanische, sie ist schließlich da, in diese Stadt, in das Land völlig einzutauchen). Ihr Englisch wird besser, sie diskutiert an den Abenden mit den neuen Freunden, die Themen stehen ihr vor Augen: Rassenprobleme, die Situation der New Yorker Juden, die Gefahren des Kalten Krieges, die Ungleichheit der amerikanischen Gesellschaft, die ihr trotz des Wohlstandes sofort in die Augen sticht. Mitte Februar beginnt ihre Vortragsreise, die sie bis an den Pazifik bringt, sie kehrt Ende April nach New York zurück, diesmal ins West-Village, wo sie ein Quartier-Leben führt mit Nachbarn, Freunden und kleinen Bummeleien, wie sie es aus Paris kennt. Sie fühlt sich angekommen, vielleicht auch nicht zuletzt, weil sie einen amerikanischen Liebhaber gefunden hat, einen Schriftsteller aus Chicago, dem sie ihr New York zeigen kann und mit dem sie doch ganz neue Eindrücke erlebt.
Die Zeit rennt ihr davon. Sie schläft kaum noch, beherrscht die englische Sprache leidlich, jedoch noch nicht gut genug, um – wie sie schreibt – völlig frei in ihr denken zu können. Jetzt dringt sie noch einmal tiefer ein in den amerikanischen Lifestyle, sie sieht, wie hier alles auf Geld fixiert ist und nur der ein gemachter Mann ist, der welches hat (Talent zu haben reicht dagegen nicht). Sie sieht ihre eigenen Landsleute plötzlich in einem neuen, eher unvorteilhaften Licht und sie findet ihr großes Thema, auf das sie vielleicht im eigenen Land nicht so schnell gestoßen wäre: Die Rolle der Frauen. Denn erst im Kontrast zur Französin wird ihr klar, wie umemanzipiert die von ihr vorab als unabhängig gedachte Amerikanerin ist. Es ist die Amerikareise, die den Keim legt zu ihrer großes Studie über »das andere« Geschlecht. Sie macht noch en passant eine Marijuana-Erfahrung, die keine wird, weil der Stoff bei ihr nicht anschlägt, sie isst am Ende der Reise am liebsten Hamburger mit Whisky und sie ist sich sicher, dass sie Amerika zumindest zu 50% liebt, was für eine französische Intellektuelle ihrer Zeit ein riesiges Kompliment ist. Als sie fährt, ist sie traurig. »New York hat mich akzeptiert«, schreibt sie an einem ihrer letzten Nachmittage, an denen sie an einer Ballett-Probe mit John Cage und Merce Cunningham teilnehmen darf. Den letzten Abend verbringt sie mit Freunden in Harlem. Und dann fliegt sie ins triste Nachkriegs-Paris zurück. »Ich riskierte nie etwas, ich war Zuschauer.« So klingt ihr Resümee und auch der Grund, warum sie trotz aller Begeisterung zurück muss. Sie kann trotz aller Beschäftigung keinen Alltag in New York finden, denn ihr fehlt ihre Arbeit.
Meine hiesigen Freunde gehen ihren Berufen nach, haben ihre Alltagssorgen, stehen vor den Problemen, von denen ich sprach. Ich bin eine Außenstehende. (…) Je vertrauter mir diese Welt ist, um so stärker fühle ich das Bedürfnis, einen wirklichen Platz in ihr einzunehmen – vielleicht fände ich ihn auch, wenn ich länger bleiben könnte. Aber in zehn Tagen wird nicht mehr die Rede davon sein, ihn zu suchen. New York ist keine Fata Morgana mehr, die ich erst in eine Stadt in Fleisch und Blut verwandeln muss, es ist eine betäubende Wirklichkeit, es hat die Dichte und den Widerstand der Wirklichkeit. Nichts werde ich von dieser Stadt erhalten, es sei denn, ich gäbe mich ihr ganz; um aber ein solches Geschenk möglich zu machen, müsste ich meine Existenz von Grund auf ändern. Es ist mir bestimmt, hier nur Besucherin, Durchreisende zu sein. Morgen früh werde ich mir ein Flugbillett für Chicago reservieren lassen.Rezension von Stephanie Jaeckel