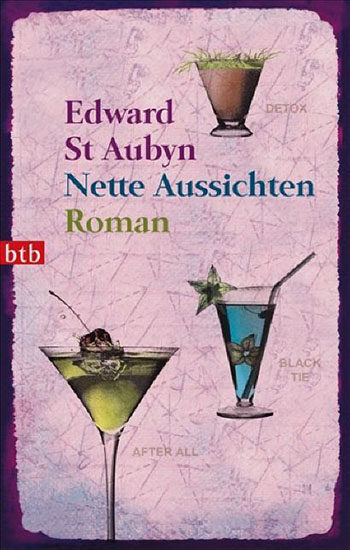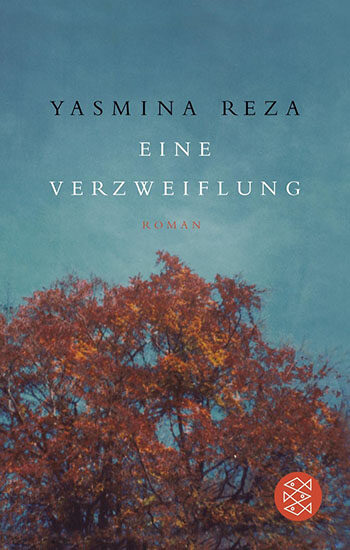von Laurence Tardieu
Weil nichts bleibt, wie es ist
Ich sterbe, hat sie mir geschrieben, Vincent, ich sterbe, komm mich besuchen, komm ein letztes Mal zu mir, damit ich Dich sehe, Dich berühre, Dich höre, komm zu mir, Vincent, ich sterbe.Liebe ist ja meistens vergänglich, sozusagen etwas zeitlich Befristetes, auch wenn wir es uns gern anders wünschen und vielleicht auch einreden. Wirkliche Liebe ist doch verhältnismäßíg selten, das meiste, was das Etikett »Liebe« trägt, ist vielmehr eine Laune oder ein kurzer Zwischenstopp auf der Reise durchs Leben.
Laurence Tardieu erzählt im vorliegendem Buch von einer anderen Liebe, einer, die Jahre überdauert und dennoch nicht oder zumindest kaum an Intensität verliert: Vincent und Geneviève haben sich über fünfzehn Jahre lang nicht gesehen, sie sind damals, nachdem ihre Tochter eines Tages nicht von der Schule nach Hause kam, getrennte Wege gegangen. Die ersten Wochen und Monate waren die härteste Zeit, die das Leben für sie bereit gehalten hatte. Vincent ist in eine regelrechte Lethargie verfallen, hat kaum noch ein Wort gesprochen, ganze Stunden damit zugebracht, stumm durch das dunkle Wohnzimmer zu schleichen und sich in seinen Gedanken gegen die Außenwelt hermetisch abzuriegeln. Auch Geneviève hat gelitten, wie man als Mutter eben unter dem spurlosen Verschwinden der einzigen Tochter leidet, aber sie hat sich ein wenig Kraft zurückerobern können, sie hat ihre Gefühle aufgeschrieben, hat immer wieder das verlassene Kinderzimmer aufgesucht, um ihre Erinnerung an Clara nicht gänzlich verblassen zu lassen und dadurch auch gegen den Wahnsinn anzukämpfen.
Vincent ist in die Stadt gezogen, um sich abzulenken; Geneviève hat die Einsamkeit des Landes gesucht und ein Haus in einem kleinen Dorf gekauft. Seitdem sind, wie gesagt, fünfzehn Jahre vergangen, und nun hat Vincent einen Brief seiner Jugendliebe erhalten: Geneviève liegt im Sterben. Vincent überlegt nicht lang, er macht sich auf den Weg zu ihr und ein letztes Mal treffen die beiden aufeinander, um sich Lebewohl zu sagen und die gemeinsame Vergangenheit noch einmal zwischen sich zu legen. Für Vincent ist es beinahe eine Mutprobe: Die Liebe von damals ist immer noch allgegenwärtig zwischen ihnen zu spüren, und auch Clara, so scheint es jedenfalls, taucht noch einmal aus dem Dunkel auf, um sich von ihren Eltern zu verabschieden.
Obwohl vor allem die Sprache, in der das alles erzählt wird, immer wieder ganz nah am Rand zum grenzenlosen Kitsch steht und die Bilder, die Tardieu bemüht, nicht neu sind, haftet diesen Seiten dennoch etwas ganz Eigentümliches an, das es mir unmöglich machte, das Buch einfach zur Seite zu legen. Es ist eine Geschichte, die man auf der Leinwand mit viel Dunkelheit und Streichorchester in Szene setzen würde, mit gesenkten Blicken, ganz kleinen Gesten und nichts als den gedämpften Geräuschen des Windes draußen vor den Fenstern. Und das ist nichts Schlechtes: Es ist eine Geschichte, die trotz ihrer stilistischen Überladenheit anrührend von einer Bindung zwischen zwei Menschen erzählt, wie es sie eben nur sehr selten gibt. Es stellt sich eine regelrecht beruhigende Mattigkeit beim Lesen ein, die unglaublich stark ist und es geschafft hat, mich Seite um Seite weiter in einen Kokon einzuweben, in dessen Inneren nur dieses kleine Haus steht, in dem Geneviève und Vincent die letzten gemeinsamen Stunden verbringen. Sogar das von Beginn an eindeutig Hoffnungslose ihrer Liebe kippt irgendwann und lässt den Leser nicht allein vor einem großen schwarzen Loch zurück, sondern gibt ihm am Ende sogar noch ein gerührtes Lächeln mit auf den Weg. Ein ganzes Stück entfernt von konsequenter Schwarzmalerei, wie es die Geschichte nahelegen würde, bleibt trotz allem noch Platz für ein wenig Zufriedenheit und ... ja, vielleicht sogar Glück.
Wenn doch nur mehr Liebesgeschichten so wären wie diese!

Weil nichts bleibt, wie es ist
von Laurence Tardieu
128 Seiten, € 7,95,
List, ISBN 978-3548608433
Patricia Klobusiczky
List, ISBN 978-3548608433
Patricia Klobusiczky
Rezensiert von Alexander Schau

Alex lebt schon eine Weile nicht mehr in Leipzig, liebt aber immer noch Ebooks und liest eigenen Angaben zufolge durchschnittlich 6,73 Bücher pro Monat. Paulo Coelho findet er immer noch widerlich, daran hat auch der Umzug nichts geändert.