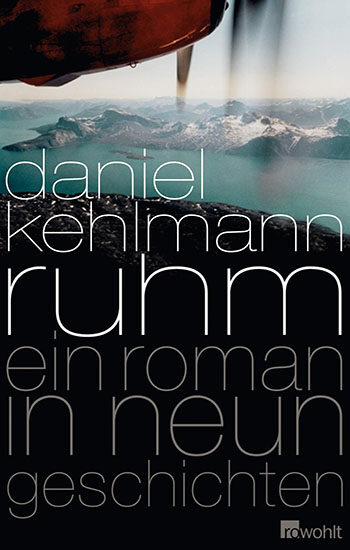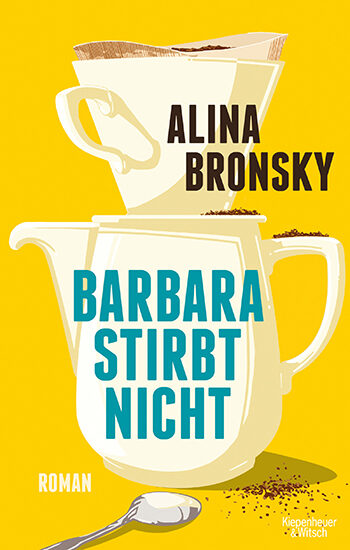von Willy Vlautin
Motel Life
In der fraglichen Nacht war ich betrunken, fast schon bewusstlos, und ich schwöre bei Gott, ein Vogel hat mir das Motelzimmerfenster eingeschlafen.Die ersten Assoziationen, die mir bei dem Titel in den Kopf kommen: Amerika. Der Geruch von Öl und fettigen Spare Ribs in den Straßen. Sand und Schmutz. Völlig kaputte Menschen, die sich mit Zigaretten und billigem Fusel über den Tag retten. Hier und da Hurerei.
Dass ich in diesem Buch allerdings noch viel mehr finden sollte als nur diese ganzen billigen Klischees, hat mich umso mehr berührt: Dieses ruppig-reale Amerika dient nur als ein Hintergrund, vordergründig aber gescheiht hier viel mehr, als man zuerst annehmen mag.
Frank und sein älterer Bruder Jerry Lee sind auf dem Weg durch die Staaten, von einem nichtssagenden Ort zum nächsten, von Motel zu Motel. Jerry Lee hat mitten in der Nacht einen kleinen Jungen überfahren, im tiefsten Schneegestöber, und er hat Fahrerflucht begangen. Er war betrunken, und wer würde ihm schon glauben, dass er wirklich unschuldig war, dass der Junge urplötzlich auftauchte, ohne dass er reagieren konnte? Zusammen mit seinem Bruder macht er sich also auf die Flucht, obwohl es keine konkreten Beweise gibt, niemand hat etwas gesehen.
Jerry Lee wird von heftigen Gewissensbissen geplagt, das alles belastet ihn so sehr, dass er kurz davor ist, sich eine Kugel in den Kopf zu jagen. Im letzten Moment fehlt ihm dafür die Kraft, er scheißt sich ins Bein, will einfach nur daliegen in der Pampa und elendig verbluten. Er wird gefunden, ins Krankenhaus gebracht, wo sein Bruder Frank ihn kurz darauf wieder rausholt und abermals mit ihm abhaut. Sie fahren irgendwohin, landen in Elko; zufällig, wie Jerry Lee denkt, doch Frank ist auf der Suche nach seiner großen Liebe Annie. Und die wohnt inzwischen in Elko.
Wir sind Typen, die Scheiße bauen, Frank, also müssen wir mit Typen zusammen sein, die Scheiße bauen. Ich finde das ganz logisch. Aber das sind doch deshalb keine schlechten Menschen,oder? Wenn man einmal Pech hat, heißt das doch nicht, dass man immer Pech hat, oder? Es gibt Leute, die fallen so oft auf die Schnauze, dass sie irgendwann mal Glück haben müssen. Nicht jeder ist verflucht, glaube ich jedenfalls. Und du brauchst jemanden. Du vor allem, von allen Typen auf der Welt. Du bist der einsamste Mensch, den ich kenne. Alle sagen das.Alles in allem ist Frank eigentlich ein ganz lausiger Erzähler, der es wirklich versteht, auch der spannendsten und interessantesten Begebenheit durch seine Apathie jeglichen Reiz zu nehmen. Die Geschichten hingegen, die er seinem Bruder am Krankenbett erzählt, sind dann plötzlich immer ganz anders, locker, lebendig. Das sind wirklich schöne Stellen, nur leider gibt es davon verhältnismäßig wenige. Der Großteil des Romans besteht vielmehr aus Gängen, Einkäufen und american name dropping. Abschließend betrachtet, bleibt die Geschichte doch ziemlich weit hinter den Erwartungen zurück - oder ich bin für diesen Roman einfach nicht feinfühlig und offen genug. Pressestimmen wie »So etwas zu schreiben hat sich in letzter Zeit in Deutschland keiner getraut.« sind in meinen Augen jedenfalls maßlos übertrieben, denn genau genommen erzählt Vlautin nichts anderes als einen durchschnittlichen Road Movie. Da bleibt dann am Ende kaum etwas übrig, was mich als Leser besonders beeindruckt hätte, wenn ich von der tatsächlich mit viel (und überzeugender!) Zuneigung gespickten Bruderliebe und einigen wenigen Stellen absehe, die mir etwas vermittelt haben, ein Bild oder ein Gefühl oder einen Gedanken. Das ist mir aber leider nicht genug.
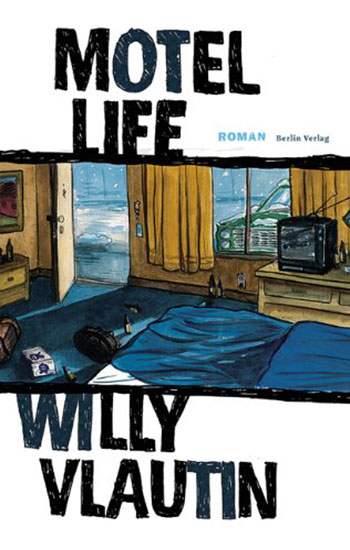
Motel Life
von Willy Vlautin
208 Seiten, € 9,95, broschiert / kartoniert
Berlin Verlag, ISBN 978-3833306075
aus dem Englischen von Robin Detje
Berlin Verlag, ISBN 978-3833306075
aus dem Englischen von Robin Detje
Rezensiert von Alexander Schau

Alex lebt schon eine Weile nicht mehr in Leipzig, liebt aber immer noch Ebooks und liest eigenen Angaben zufolge durchschnittlich 6,73 Bücher pro Monat. Paulo Coelho findet er immer noch widerlich, daran hat auch der Umzug nichts geändert.