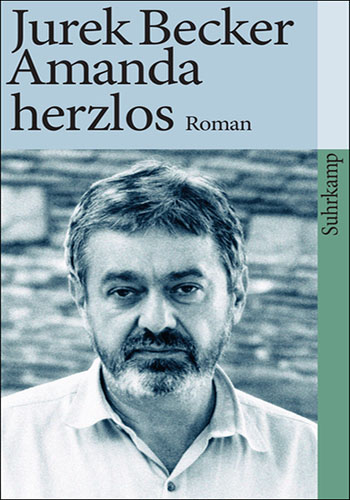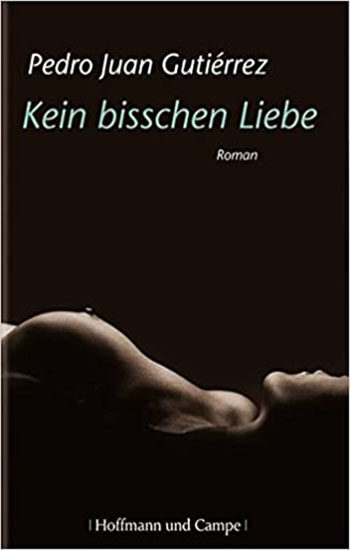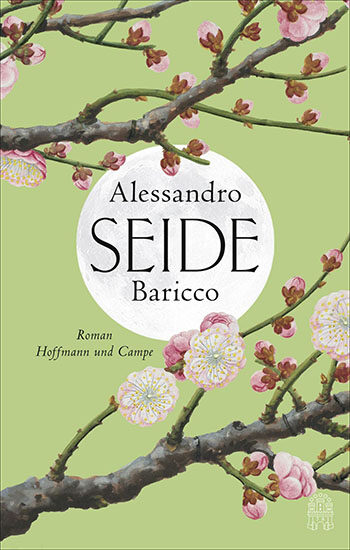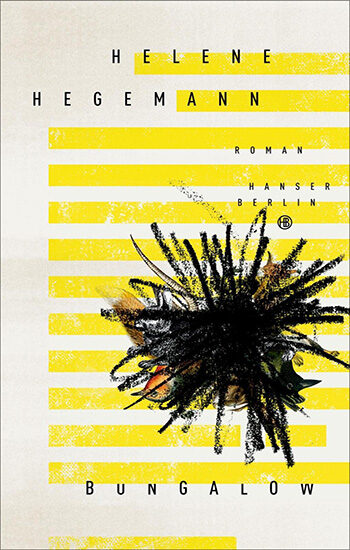von Roger Willemsen
Afghanische Reise
Im Dunkeln hörte ich den Gärtner, der die Veranda mit einem Reisigbesen fegt. Wenig später wird der Wagen der Müllentsorgung halten, und aus dem Nebenzimmer dringt das Geräusch eines schleifend geöffneten Fensterladens. Das dreckige Licht, das durch den halbgeöffneten Laden fließt ist mit Nebel vermischt. Es ist feuchtes Licht.Vor zwei Jahren etwa war es, als ich Roger Willemsen in der Harald-Schmidt-Show beobachtete. Dort berichtete er aus seinem damals aktuellen Programm, welches er anstelle einer Lesung seines Buches »Afghanische Reise« veranstaltete. Mit gewohnt großer Eloquenz beschrieb er Erlebtes und Ereignetes. Mir war, als regte sich Interesse.
Ich ging hin, erwarb dieses Buch, legte es jedoch beiseite, ohne es, trotz eben jener Wissbegierde wegen, weiter zu verfolgen. Woher dieses Verkümmern kam, war nicht mehr nachzuvollziehen, schien aber seine Begründung wieder gefunden zu haben, als ich es schließlich beendete. Sie ist sehr wohl zu spüren, seine Begabung mit Sprache umzugehen, sie einzusetzen und zu gebrauchen. Sie Inhaltlich zu beladen geht ihm in diesem Werk allerdings ab. Es ist so fad wie die afghanische Steppe, steinig und trocken. Wüsten jedoch haben manchmal Oasen. In einer solchen Oase, gleichsam hier sein Aufbruchpunkt zu einer langen, strapaziösen wie durstigen Reise durch die Trockenheit, beginnt er in einem Hotel in Locarno Überlegungen anzustellen, deren Fragestellung viele Erwartungen wecken:
Jede Reise, die man beschreibt, beginnt mit der Frage: Wo war ich? Im Doppelsinn: Wo wurde der Erzählfaden des alltäglichen Lebens unterbrochen, und wie findet man heraus, wo man wirklich war?Mit einem Zitat des Malers Odilon Redon versucht er sich seinen Fragen anzunähern. Hier spürt man noch die Hypothek des Germanisten, Kunsthistorikers und Philosophen Roger Willemsen, doch der zitierte Erzählfaden wird jäh unterbrochen.
Optisch jeweils als Absatz von einander getrennt, springt die Handlung innerhalb von zwei Seiten über zu einem Taxifahrer, einer Dame am Schalter eines nicht genannten Zubringerflughafens, zurück zu einem weiteren inneren Monolog, weiter zum Frankfurter Flughafen und landet schließlich bei Nadia. Ob dieses Hinundherspringen als Retardierendes Moment angelegt worden war, bleibt verborgen. Es zieht sich durch das gesamte Werk, hat allerdings wenig von der eigentlichen Funktion dieses Elementes, stiftet vielmehr noch Verwirrung, wenn der Leser, vermeintlich schon weiter vorangeschritten, wieder zurückversetzt wird und sich erneut in Ort und Zeit einfinden muss.
Nadia trägt einen roten Gazeschleier, den sie um den Kopf gebunden hat als Referenz an das Land, das kommt.– und ist eine Begleiterin im Land wie im Buch. Sie soll, so vermute ich, eine Mittlerin sein. Doch stellt sich hier die Frage: in einem Land, in dem die Scharia lange Zeit anerkanntes Recht war, dem religiös motivierte Unterdrückung der Frauenrechte als Kriegsgrund vorgehalten wurden und das überladen ist vom Klischeedenken der westlichen Welt, wie erfolgreich wird sie sein? Doch bevor sich dieses Politikum weiter verfestigt, springt die Handlung wie so oft weiter. Der Leser wird ebenso zum Reisenden, zum Städtereisenden, der genug Zeit hat, sich alles Sehenswerte anzuschauen und vielleicht noch ein Foto machen kann, bevor die Karawane auch schon weiter zieht. Was man sieht, kann durchaus interessant sein, doch bevor man es vertieft, eilt man zum nächsten Ort, schaut in die grelle Sonne und orientiert sich neu. Alles zuvor Wahrgenommene verkommt in der Trivialität und bleibt so spannend wie die ältere Nachbarin beim Wäscheaufhängen.
Hin und wieder birgt das Buch dennoch lichte Momente. Wenn es zu Anekdoten kommt, die schockierend oder unterhaltsam sind. Da ist die Bettlerin, die sich bei Nachbarn die Kinder ausleiht, gegen eine Gebühr, um auf der Mitleidsschiene mehr Geld erbetteln zu können, oder die Ältesten des Dorfes, die sich unter einem deutschen Verkehrsschild versammeln und überlegen, was es zu bedeuten habe. Doch waren es genau diese Geschichten, die in der Harald Schmidt Show mein Interesse weckten, womit sich der Kreis auch wieder schließt, denn mehr als diese wenigen Höhepunkte hat die »Afghanische Reise« nicht zu bieten. Einzig eine Botschaft sticht immer wieder hervor: Es ist Krieg, den Menschen geht es schlecht. Das ist traurig und schlimm, doch leider auch nicht neu.
Wenn ich bisher Großes von Roger Willemsen gehalten habe, mich ergötzte an seiner Eloquenz und Intelligenz, so bleibt mir abschließend zu diesem Buch nur ein Zitat von ihm zu nennen, eine Randbemerkung: »Image ist dazu da, um es zu schänden.« Und ich möchte sagen: Herr Willemsen, dies sei vollbracht.
Nun, da dieses Buch als ein spezielles Stück vor mir liegt, meine ich, der Stempel auf den Seiten hätte auch in großen Bild-Lettern als Titel herhalten können: Mängelexemplar.

Afghanische Reise
von Roger Willemsen
Rezensiert von Alexander Schau

Alex lebt schon eine Weile nicht mehr in Leipzig, liebt aber immer noch Ebooks und liest eigenen Angaben zufolge durchschnittlich 6,73 Bücher pro Monat. Paulo Coelho findet er immer noch widerlich, daran hat auch der Umzug nichts geändert.