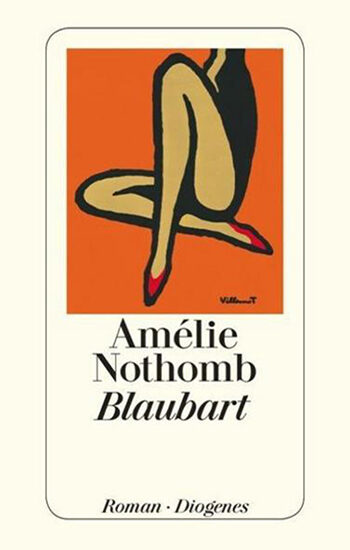von Dan Simmons
Song of Kali
Manche Orte sind so böse, dass man ihre Existenz nicht dulden sollte. Manche Städte sind so wüst, dass man sie nicht ertragen kann. Kalkutta ist so eine Stadt. Vor Kalkutta hätte ich über diese Vorstellung gelacht. Vor Kalkutta glaubte ich nicht an das Böse – gewiss nicht, als eine von den Taten der Menschen unabhängige Kraft. Vor Kalkutta war ich ein Narr.Robert Luczak arbeitet für ein Literaturmagazin und nimmt von einem zweiten Magazin den Auftrag an, nach Kalkutta zu reisen um ein Manuskript eines sehr erfolgreichen, aber eigentlich toten Dichters zu beurteilen und zur Veröffentlichung mitzubringen. Ehefrau Amrita und Säugling Victoria begleiten ihn, denn Amrita ist mehrsprachig und stammt aus Indien.
Neben Klima und Dreck der überbevölkerten Metropole belastet Robert Luczak eine Reihe von Begegnungen; angefangen von Krishna, der die Familie abholt und sich unerträglich harsch gegenüber seinen Mitbürgern verhält, über den Schriftstellerverband, der in stickig-schwüler Runde bei rußigen Kerzen tagt bis hin zu einem Studenten, der Mr. Luczak in einem funzeligen Coffeeshop von der Begegnung mit der Sekte der Kapalikas erzählt, deren Aufnahmeritual das Mitbringen einer Leiche erfordert.
Die Sekte dient Kali, der Göttin der Zerstörung. Die Leiche soll der tote Dichter gewesen sein. Luczak fordert daraufhin nicht nur das Manuskript, sondern auch, den Dichter zu treffen.
Mehr sei hier nicht verraten, denn weiteren Begegnungen, Rituale, eine Entführung und andere Reiseziele dürfen dem neugierigen Leser hier nicht vorweggenommen werden.
Die Kerzen waren schon halb heruntergebrannt und flackerten heftig, obwohl sich kein Wind regte. Mir war schrecklich heiß und ein wenig übel. Einen wahnsinnigen Augenblick lang schien mir, als würden die Kerzen niederbrennen und wir weiter in der feuchten Dunkelheit reden, Geister ohne Körper, die in einem verfallenden Gebäude im Bauch einer toten Stadt spukten.Stephen King beneidet Dan Simmons, wenn es um die Art des Schreibens geht, verrät das Zitat auf der Rückseite des Buches. Schade, Stephen King.
Das Buch wird als Horrorroman bezeichnet. Das ist zutreffend, bezieht sich aber weniger auf die Handlung oder die Motive, sondern auf den Stil. Üblicherweise folgt auf einen kurzen Satz Handlung immer ein langer Satz Stimmung, der eher ablenkt als verdeutlicht. Ein Beispiel: Das nächtliche Licht in Kalkutta sieht ungewohnt aus. Nachdem Dan Simmons die unterschiedlichen Lichtquellen aufzählt und deren Zusammenspiel bereits ausreichend als »weiches Leuchten« bezeichnet hat, schiebt er noch eine »pilzartige Phosphoreszenz […] aus tausend unsichtbaren Quellen« hinterher. Und als ob das noch nicht genug gewesen wäre, folgen »Myriaden Feuer Kalkuttas« und Vergleiche mit bombardierten europäischen Städten.
Literaten wählen an dieser Stelle ein treffendes Bild. Dan Simmons bewirft den Leser solange mit Bildern, bis es auch der Letzte garantiert kapiert hat.
Manchmal ist das gewählte Bild auch einfach nicht zutreffend: Als Luczak eine sinnliche Frau trifft und ihre faszinierende Schönheit beschreibt, wählt Dan Simmons dazu diese Worte: »Das Ebenbild der jungen Frau brannte sich auf meinen Netzhäuten ein wie das optische Echo eines Blitzlichts.«
Igitt. Erregung soll über die Vorstellung einer Netzhaut transportiert werden und ein Nachbild (ja, es gibt ein Wort dafür) wird verschwurbelt als »optisches Echo« erklärt. Literatur geht eindeutig anders.
Es gibt Lichtblicke, wenn man bis zum Ende durchhält. Gut beobachtete und recherchierte Einblicke in die vielschichtige indische Gesellschaft. Einen Seitenhieb auf Stephen King. Einen treffend erfassten Kulturschock eines westlichen Wohlstandsbürgers. Und in der Mitte des Buches gibt es ein dringend zu lobendes, kluges und amüsant frotzelndes Gespräch zwischen den Eheleuten. Hier ein kurzer Einblick in den Versuch der Mathematikerin Amrita ihrem Mann etwas zu erklären:
»Was wäre der Unterschied?« »Ich denke Du kennst Euklid!« »Wir wurden einander vorgestellt, sind aber nie dazu gekommen, uns das »du« anzubieten.« Amrita seufzte.Fazit: Das Buch ist lesbar, wenn man sich geistig gern in der indischen Kultur aufhält, wenn man krimiartige Spannung mag und nicht erwartet, sich zu gruseln, wenn man eine langsam voranschreitende Handlung in Ordnung findet und man über die unwegsamen Bilder hinwegsehen kann. Ansonsten bitte lieber einfach Edgar Allan Poe oder Gustav Meyrink lesen.
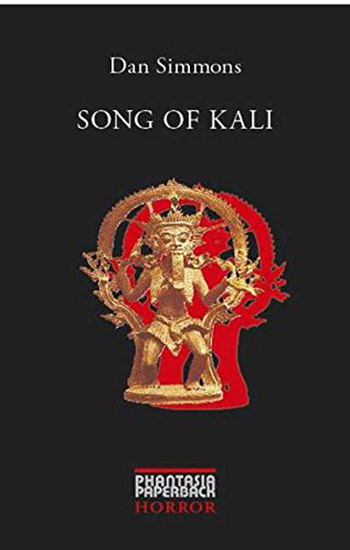
Song of Kali
von Dan Simmons
Rezensiert von Anna Gierden
Anna lebt und liest in Leipzig, geht manchmal zur Buchmesse und zu Lesungen. Es dürfen Kunstmärchen und Popliteraten sein, bei allem dazwischen ist sie zickig. — Anm. d. Redaktion: Stimmt.