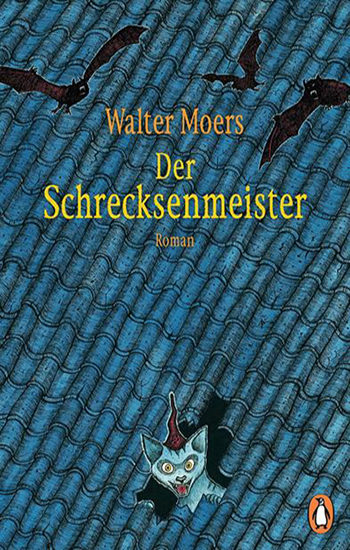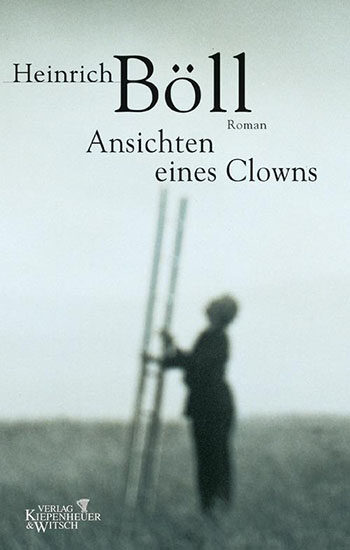Flamingostar
Schwarz. Alles schwarz. Der Himmel, die Häuser, das Wasser weit unter mir, meine Hände, die ich jetzt dicht vor meine Augen halte, um zu sehen, ob sie zittern: schwarz.Justus von Schweben, Hauptfigur und Ich-Erzähler in Erik Brandt-Höges zweitem Roman »Flamingostar«, ist ein ganz schön tougher Kerl: Behütet aufgewachsen in einer Villa am Berliner Stadtrand, will er nach dem Abi endlich seinen großen Traum leben und Musiker werden. Er will auf der Bühne am Klavier sitzen und seine selbstgeschriebenen Songs spielen, die von Trauer, Wut, Hoffnung und vor allem natürlich auch der puren Liebe handeln.
Anwaltspapi hingegen sähe es lieber, übernähme der Sprössling nach dem Jurastudium die väterliche Kanzlei. Justus aber denkt gar nicht daran, und so nehmen die Dinge ihren Lauf.
Im »Flamingo« darf Justus das erste Mal vor Publikum spielen. Es sind zwar nur eine Handvoll Leute da, aber dieser erste Auftritt ebnet Justus’ Weg: Der
Justus erhält bereits kurz darauf einen eigenen Plattenvertrag. Auf Martins Idee hin wird ein Youtube-Video aufgenommen, um den Jungen im Internet bekannt zu machen. Kurz darauf geht’s auf Tour – zwar nur als Support, aber immerhin.
Und dann ... ach, wen interessiert’s. Kommen wir endlich zum Verriss:
»Flamingostar« ist zusammengefasst ein beängstigend ideenloser Aufguss aller erdenklichen Branchenklischees. Es geht um böse Manager, die immer alles besser wissen und falsche Entscheidungen treffen; es geht um Möchtegernstars, die sich aber wie die ganz Großen aufführen; es geht um Groupies, um voll fiese Interviewfragen und Warmhaltebehälter im Backstagebereich.
Am Ende für Justus dann irgendwann die Einsicht, dass im Showgeschäft nicht alles Gold ist, was glänzt.
Hui, sag bloß.
Die größte unter vielen Schwächen dieses Romans ist zweifellos die Tatsache, dass der Autor anscheinend selbst nicht weiß, warum er dieses Buch geschrieben hat. Soll das Satire sein? Auf das kapitalistische Mahlwerk der Unterhaltungsindustrie? - Gääähn, ist es nicht. Satire hat Biss; diese Geschichte hingegen ist nichts weiter als eine plumpe Aneinanderreihung von, wir sagten es schon, Klischees. Da steckt nichts dahinter, da ist überhaupt nichts Neues, nichts Eigenes oder wenigstens gut Kopiertes dabei. Dieses einfallslose Aufzählen und Abkupfern macht auch vor dem ZDF-Fernsehgarten und Dieter Bohlen als Vorlage eines Castingshow-Jurors nicht halt. Kennen wir alles. Laaangweilig.
Was außerdem ärgerlich ist: Die Figuren selbst sind ohne jede Tiefe oder aber - was eigentlich noch viel schlimmer ist - stinklangweilig. Der bereits erwähnte Interessen»konflikt« zwischen Papa und Sohnemann könnte, richtig ausgebaut, durchaus für die nötige Würze sorgen, wird dann allerdings doch nur kurz hingeschmiert und muss fortan ohne jedes Fundament großkotzig als der gefühlsmäßige Aufhänger für Revoluzzerjustus' Taten herhalten; der ach so kontrollierte Juristenpapa greift in der Konsequenz zum Alkohol (ganz neu!) und immer öfter auch zum Telefon, über das er Justus gegenüber so ganz nebenbei dann auch noch die Hintergründe des Autounfalls der Mutter enthüllt. Das alles wirkt so hilflos konstruiert, so übergestülpt, dass es einen einfach nicht weiter interessiert. Am Ende ist Papa natürlich Sohnemanns größter Fan, die beiden versöhnen sich, sitzen bei Streuselkuchen zusammen auf der Terrasse und hören Söhnchens erste CD, und sie lebten glücklich und zufrieden und blablabla.
Das alles ist weder besonders witzig noch originell. Das ist weder für Branchenkenner noch Außenstehende spannend. »Flamingostar« ist mit ziemlicher Sicherheit und großem Abstand eines der bräsigsten Bücher, die seit langem veröffentlicht wurden.

Flamingostar
Rezensiert von Alexander Schau

Alex lebt schon eine Weile nicht mehr in Leipzig, liebt aber immer noch Ebooks und liest eigenen Angaben zufolge durchschnittlich 6,73 Bücher pro Monat. Paulo Coelho findet er immer noch widerlich, daran hat auch der Umzug nichts geändert.